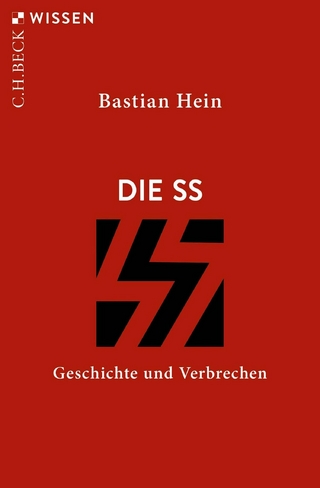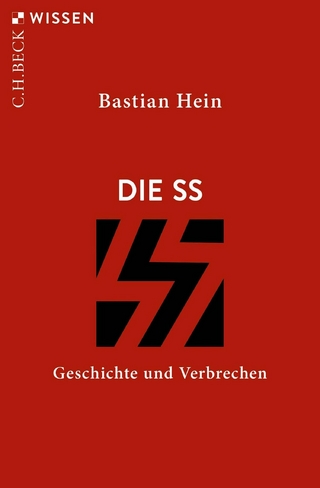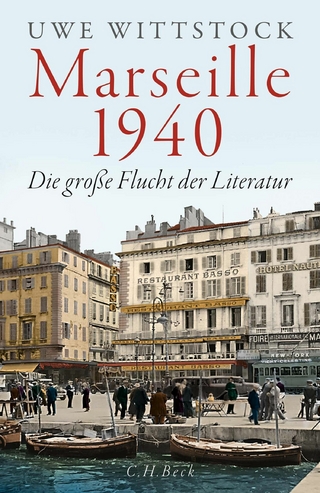Talar und Hakenkreuz (eBook)
705 Seiten
Verlag C.H.Beck
978-3-406-81343-6 (ISBN)
Michael Grüttner lehrte Neuere Geschichte in Hamburg, Berlin und Berkeley. Seit seinem Buch "Studenten im Dritten Reich" (1995) hat er sich intensiv mit den Universitäten im Dritten Reich und der nationalsozialistischen Wissenschaftspolitik beschäftigt. Für den "Gebhardt", das bedeutendste Handbuch der deutschen Geschichte, schrieb er den Band über das Dritte Reich in den Jahren 1933-1939 (2015).
Einleitung
Die Universitäten blicken auf eine fast tausendjährige Vergangenheit zurück und gehören damit zu den langlebigsten Institutionen der europäischen Geschichte. Ihre Bedeutung hat im Laufe der Zeit immer mehr zugenommen. Nie zuvor war die Zahl der Universitäten, der Lehrenden und der Studierenden so groß wie in der Gegenwart. Die im 19. und 20. Jahrhundert entstehenden Forschungsuniversitäten verstanden sich als Orte der Aufklärung oder definierten sich sogar als «Hüterinnen von Wahrheit und Gerechtigkeit», wie es 1919 in einer öffentlichen Erklärung der deutschen Universitäten hieß.[1] Die vorliegende Untersuchung stellt die Frage, wie sich Einrichtungen, die mit einem so ambitionierten Selbstbild ausgestattet waren, in der Zeit der nationalsozialistischen Diktatur verhalten haben.
In den fast 80 Jahren, die seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs vergangen sind, hatten es die Universitäten im Allgemeinen und die Historiker im Besonderen nicht eilig, sich mit dieser Frage näher auseinanderzusetzen. Das änderte sich in den 1990er Jahren, als erstmals zahlreiche Studien zur Geschichte verschiedener Hochschulen, Fakultäten und Institute oder auch einzelner Disziplinen und Hochschullehrer im Nationalsozialismus publiziert wurden. Eine Gesamtdarstellung der Universitätsgeschichte im Nationalsozialismus fehlte jedoch bislang.
Mehrere Anläufe sind in der Vergangenheit gescheitert. Einen besonders ehrgeizigen Versuch startete der Historiker Helmut Heiber, ein langjähriger Mitarbeiter des Münchener Instituts für Zeitgeschichte, der in den 1990er Jahren eine fünfteilige Geschichte der Universität unterm Hakenkreuz ankündigte. Das Mammutprojekt wurde indes schon nach Publikation der Teile I und II eingestellt.[2] Die drei veröffentlichten Bände mit einem Gesamtumfang von über 2000 Seiten zeichnen sich durch eine beeindruckende Kenntnis der Quellen aus, aber auch durch die erkennbare Freude des Verfassers, das gefundene Material weitgehend ungefiltert, gern in anekdotischer Form, zu präsentieren, und durch den Unwillen, die Darstellung durch Fragestellungen, Thesen oder Typologien zu strukturieren. Heibers Werk ist daher ein monumentales Fragment geblieben, das aufgrund seiner Materialfülle für die weitere Forschung dennoch unverzichtbar ist.
Die Fragestellungen, Schwerpunkte und Narrative der Forschung haben sich in den vergangenen Jahrzehnten deutlich verändert. In der älteren Literatur wurden die Universitäten zumeist als ein mehr oder weniger passives Objekt oder sogar als Opfer des NS-Regimes wahrgenommen. Es dominierte die Einschätzung, dass letztlich nur wenige «wirkliche» Nationalsozialisten in den Lehrkörper der Universitäten gelangt seien. Die Mehrheit der Wissenschaftler habe ihre traditionelle Arbeit fortgesetzt, als sei nichts geschehen. Die Frage nach der Anpassung der Wissenschaft an das NS-Regime beschränkte sich in der Regel auf die ideologische Anpassung. Vorherrschend war ferner die Deutung des Nationalsozialismus als eine wissenschaftsfeindliche Ideologie. Das neue medizinische Paradigma der Eugenik und die verbrecherischen Humanexperimente, die während des Krieges an KZ-Häftlingen oder Kriegsgefangenen stattfanden, wurden als «Pseudowissenschaft» deklariert und damit aus der Wissenschaftsgeschichte ausgegliedert.
Das war nicht alles falsch. Keine andere staatliche Institution wurde nach der nationalsozialistischen Machtübernahme so stark durch politisch motivierte «Säuberungen» dezimiert wie die Universitäten. Zudem erfuhren die Hochschulen nach 1933 einen erheblichen Verlust an Autonomie. Gleichwohl sind die Universitäten keineswegs nur Objekte nationalsozialistischer Herrschaft gewesen. Die Gleichschaltung der Hochschulen wurde 1933/34 nicht allein von außen vorangetrieben, sondern auch von innen. Und es waren nicht nur die Studierenden, die sich daran beteiligten, sondern auch Teile des Lehrkörpers. Die zahlreichen Parteieintritte von Hochschullehrern schon im Frühjahr 1933 sprechen eine deutliche Sprache. In allen wissenschaftlichen Disziplinen exponierten sich Hochschullehrer 1933/34 als aktivistische Vordenker einer neuen, nationalsozialistischen Wissenschaft.
Selbstverständlich ist auch die Frage, wie weit die NS-Ideologie Eingang in die universitäre Wissenschaft gefunden hat, sinnvoll, ja sogar notwendig. Allerdings war die ideologische Anpassung keineswegs so selten, wie lange Zeit behauptet wurde, und sie war nicht der einzige Weg, um als Wissenschaftler dem Regime zuzuarbeiten. Auch eine Forschung, die sich weiterhin traditionellen fachlichen Standards verpflichtet fühlte, konnte für die neuen Machthaber von großem Nutzen sein, wenn sie mit politischen Zielen des Nationalsozialismus wie Aufrüstung oder Autarkie im Einklang stand.
Gegen die behauptete Wissenschaftsfeindlichkeit des Nazi-Regimes spricht die simple Tatsache, dass die staatlichen Aufwendungen für die Wissenschaft seit 1933 nicht reduziert, sondern aufgestockt wurden. Der Nationalsozialismus stand der wissenschaftlichen Forschung nicht grundsätzlich feindselig gegenüber, wollte aber eine Wissenschaft, die seinen politischen Zielen diente. Es gibt auch keine vernünftigen Gründe, die Institutionalisierung der Eugenik oder tödlich verlaufende Humanexperimente pauschal als pseudowissenschaftlich abzutun. Die Eugenik war 1933 bereits eine international etablierte Strömung, und bei den medizinischen Versuchen mit unfreiwilligen Versuchspersonen handelte es sich um Forschungen, deren Problematik nicht in ihrer Unwissenschaftlichkeit lag, sondern in der brutalen Missachtung ethischer Regeln und Grenzen, die 1931 vom deutschen Staat klar definiert worden waren.
In der jüngeren Forschung erfreut sich der Begriff «Selbstmobilisierung» großer Popularität – ein Begriff, der auch in dieser Arbeit benutzt wird, weil er die Bereitschaft von Wissenschaftlern kennzeichnet, die eigene Forschung auf die politischen Bestrebungen des Regimes auszurichten. Ursprünglich bezog sich dieser Terminus auf die Bemühungen von Hochschullehrern in der zweiten Kriegshälfte, die Natur- und Technikwissenschaften stärker für die Rüstungsforschung einzusetzen.[3] In den vergangenen Jahren ist daraus in manchen Arbeiten ein Schlüsselbegriff geworden, der die Handlungsweise von Hochschullehrern und Wissenschaftlern während des Dritten Reiches generell charakterisieren soll. Diese Ausweitung ist jedoch nicht unproblematisch, weil sie den Eindruck erweckt, dass das Verhalten von Wissenschaftlern im Nationalsozialismus durchweg auf Eigeninitiative und Freiwilligkeit basierte. Eine solche Sichtweise läuft leicht darauf hinaus, den diktatorischen Charakter des Regimes und die massiven Anpassungszwänge, denen insbesondere der wissenschaftliche Nachwuchs ausgesetzt war, herunterzuspielen.[4]
Die vorliegende Studie ist die erste Gesamtdarstellung der deutschen Universitätsgeschichte im Nationalsozialismus. Sie basiert gleichermaßen auf langwieriger Arbeit in den Archiven wie auf der Auswertung der wissenschaftlichen Literatur. Forschungsgegenstand sind die 23 Universitäten, die am Ende der Weimarer Republik in Deutschland existierten, ferner die vier Universitäten, die 1938/39 im Zuge der nationalsozialistischen Expansionspolitik Teil des deutschen Universitätssystems wurden (Wien, Innsbruck, Graz, Prag), und schließlich zwei kurzlebige Neugründungen, die Reichsuniversitäten Posen und Straßburg. Die Technischen Hochschulen, die damals noch keinen Universitätsstatus hatten, bleiben unberücksichtigt, ebenso die Handelshochschulen, Kunsthochschulen, Musikhochschulen, Landwirtschaftlichen Hochschulen und Bergakademien. Nur am Rande wird das Schicksal der nichtdeutschen Universitäten in den von Deutschland besetzten Ländern behandelt, die zum Teil unter veränderten Bedingungen weiterarbeiten konnten, zum Teil geschlossen wurden, mitunter aber im Untergrund aktiv geblieben sind.
Die Struktur des Buches basiert auf folgenden Überlegungen: Universitätsgeschichte lässt sich in drei Bereiche aufgliedern, den institutionellen, den personellen und den fachwissenschaftlichen.[5] Die institutionelle Ebene zerfällt wiederum in zwei Teilbereiche, zum einen die verschiedenen Institutionen, die innerhalb und außerhalb der Universitäten als hochschulpolitische Akteure hervortraten, zum anderen die Universität selbst als eine hierarchisch gegliederte, der Lehre und Forschung gewidmete Einrichtung. Die personelle Ebene umfasst sowohl die Lehrenden als auch die Studierenden. Da über die Studierenden in der Zeit des Dritten Reiches bereits seit längerer Zeit eine umfangreiche Studie vorliegt,[6] kann die folgende...
| Erscheint lt. Verlag | 15.2.2024 |
|---|---|
| Verlagsort | München |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Literatur ► Biografien / Erfahrungsberichte |
| Sachbuch/Ratgeber ► Geschichte / Politik ► 20. Jahrhundert bis 1945 | |
| Reisen ► Reiseführer ► Europa | |
| Geschichte ► Allgemeine Geschichte ► 1918 bis 1945 | |
| Geisteswissenschaften ► Geschichte ► Regional- / Ländergeschichte | |
| Technik | |
| Schlagworte | Drittes Reich • Geschichte • Hochschulpolitik • Nationalsozialismus • NS-Regime • Professoren • Universitäten • Wissenschaft • Wissenschaftsgeschichte • Wissenschaftspolitik |
| ISBN-10 | 3-406-81343-7 / 3406813437 |
| ISBN-13 | 978-3-406-81343-6 / 9783406813436 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 1,3 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich