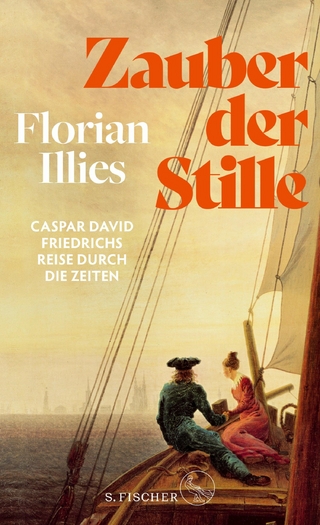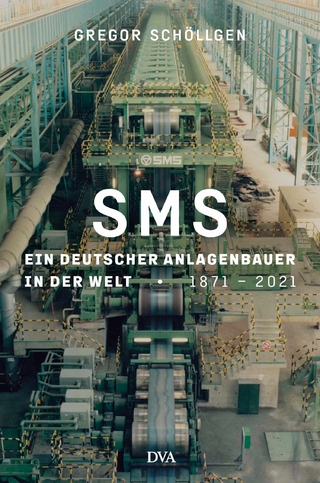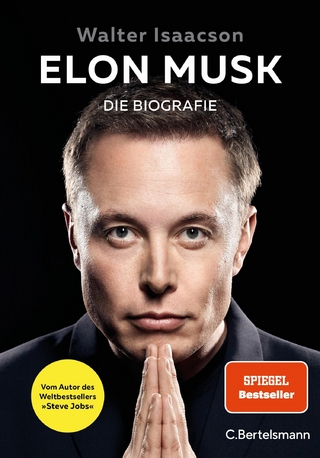Franz Kafka (eBook)
763 Seiten
C.H.Beck (Verlag)
978-3-406-68898-0 (ISBN)
Peter-André Alt, ist Professor für Neuere deutsche Literaturgeschichte an der Freien Universität Berlin, die er seit 2010 als Präsident leitet. Zuletzt ist bei C.H.Beck von ihm erschienen: Sigmund Freud. Der Arzt der Moderne (2016).
Peter-André Alt, ist Professor für Neuere deutsche Literaturgeschichte an der Freien Universität Berlin, die er seit 2010 als Präsident leitet. Zuletzt ist bei C.H.Beck von ihm erschienen: Sigmund Freud. Der Arzt der Moderne (2016).
Cover 1
Frontispiz 2
Titel 3
Zum Buch 764
Über den Autor 764
Impressum 4
Motto 5
Inhalt 7
Vorwort 13
Erstes Kapitel. Im Netz der Beziehungen 21
Hermann Kafka, Sohn eines Fleischhauers 21
Die verrückten Löwys 26
Galanteriewaren 30
Politische Kräftespiele 33
Prager Stadtansichten 43
Zweites Kapitel. Kindheit und Schuljahre (1883–1901) 48
Die Einsamkeit des Erstgeborenen 48
Drei Schwestern 53
Gouvernanten und Dienstmädchen 60
Deutsche Knabenschule 65
In der Synagoge 68
Alpträume eines Gymnasiasten 73
Türen zur Welt 84
Darwin, Nietzsche und der Sozialismus 91
Drittes Kapitel. Studium und Lebensfreundschaften (1901–1906) 97
Chemie und Germanistik 97
Geistige Ernährung durch Holzmehl 104
Philosophie im Louvre-Zirkel 107
Intime Kreise: Brod, Weltsch, Baum 112
Rituale der Sexualität 121
Die Qualen des Examens 125
Viertes Kapitel. Frühe Prosa (1900–1911) 130
Schreibversuche des Schülers 130
Kulissenzauber im Kunstwart 134
Selbstbeobachtung und Lektüre 138
Der Mythos des Kampfes 146
Hochzeitsvorbereitungen ohne Braut 155
Das Tagebuch als Versuchslabor 160
Fünftes Kapitel. Erste Berufszeit (1906–1912) 166
Am Landgericht 166
Von den Assicurazioni Generali zur Versicherungs-Anstalt 170
Alltag des Beamten 177
Nachtleben 180
Literarische Caféhauszirkel 186
Sechstes Kapitel. Auf Spurensuche (1908–1912) 194
Der Reisende 194
Naturheilkunde und Anthroposophie 204
Im Kino 214
An der Schwelle zum Zionismus 219
Das jiddische Theater 227
Siebentes Kapitel. Die Kunst der Betrachtung (1908–1913) 237
Die Gier nach einem Buch 237
Besuch in Weimar 241
Ein eleganter Verleger 245
Flaneure und Voyeure 249
Glückliche Narren, Kinder und Bauernfänger 255
Negative Dialektik 258
Achtes Kapitel. Eine Schrift-Geliebte: Felice Bauer (1912–1913) 262
Wie ein Dienstmädchen 262
Briefverkehr zwischen Prag und Berlin 265
Das Rauschen der Medien 275
Literarische Aversionen 282
Zweifelhafte Wunder 285
Von Wien zum Gardasee 292
Grete Bloch interveniert 299
Die Bestellung des Verteidigers 303
Neuntes Kapitel. Literarische Nachtarbeit (1912–1913) 308
Das Geheimnis der Psychoanalyse 308
Halbschlafbilder 312
Vollständige Öffnung des Leibes und der Seele 317
Vor dem Vater 322
Eine ekelhafte Geschichte 329
Schreibfluß und Schreibhemmung 340
Zehntes Kapitel. Der Verschollene (1912–1914) 344
Die Magie der großen Form 344
Erlesenes Amerika 347
Karl Roßmanns Brüder 354
Der Held und seine Erzieher 358
Techniken der Ironie 366
Karneval im Welttheater 369
Elftes Kapitel. Der Proceß (1914–1915) 375
Verlobung und Gerichtstag in Berlin 375
Nächtliche Ekstase 384
Rhetorik der Schuld 388
Männerphantasien – Frauenkörper 397
Richter, Advokaten und Angeklagte 403
Die Legende 408
Die Henker als Tenöre 415
Zwölftes Kapitel. Kriegsjahre ohne Entscheidungen (1915–1917) 420
Mit Felice in Bodenbach und Karlsbad 420
Zionistische Politik 423
Wunsch, Soldat zu werden 430
An den Rändern der Wirklichkeit 436
Nochmals Ehepläne 443
Dreizehntes Kapitel. Krankheit und neue Fluchtwege (1917–1918) 451
Die Verschwörung von Kopf und Lunge 451
Ein Winter auf dem Land 454
Kierkegaard-Studien 460
Paradoxe Erlösungsvisionen 462
1918: Der große Umsturz 469
Vierzehntes Kapitel. Protokolle des Schreckens (1914–1919) 475
Vortragsabend mit ‹Blutgeruch› 475
Maschinen des Gesetzes 480
Die tödlichen Spuren der Schrift 485
Stille Arbeit in der Alchimistengasse 490
Traum und Film 495
Das Fehlläuten der Nachtglocke 501
Literarische Rätselspiele 510
Imaginäres Judentum 517
Fünfzehntes Kapitel. Julie Wohryzek und Milena Pollak (1919–1921) 525
Die Tochter eines Tempeldieners 525
Der dritte Versuch 530
Milena, eine verheiratete Frau 535
Nach der Liebe 544
Kur in Matliary 550
Alte Lasten und kaum Erleichterung 558
Sechzehntes Kapitel. Selbstentwürfe und Parabeln (1917–1922) 563
Das Phantasma der Kindheit 563
Im Mahlstrom der Bedeutungen 566
Parodien des Mythos 572
Exotische Masken 579
Ostjüdische Inspirationen 582
Siebzehntes Kapitel. Das Schloß (1922) 588
Fahrt nach Spindelmühle 588
Schwarze Romantik in Böhmen 591
Ein Fremder 595
Das Dorf als hermetischer Ordnungsraum 599
Komödien des Unbewußten 603
Das Wissen der Frauen 610
Betrug und Asyl 615
Achtzehntes Kapitel. Nach der Pensionierung (1922–1923) 622
Als Ottlas Gast in Planá 622
Ein dunkler Prager Winter 627
Die Sprache des Gelobten Landes 631
Aufflackernde Palästina-Pläne 636
Die zweite Kindsbraut: Dora Diamant 639
Neunzehntes Kapitel. Späte Erzählungen (1922–1924) 644
Artisten in der Zirkuskuppel 644
Hungern als Zwang 647
Die Musik der Tiere 653
Im Labyrinth 658
Josefine und das Judentum 663
Zwanzigstes Kapitel. Die vorletzte Reise (1923–1924) 667
Nur ein Ziel, kein Weg 667
Eine Art Idylle im Grunewald 670
Der Inflationswinter 677
Odyssee durch Sanatorien und Spitäler 681
Wieder in die dunkle Arche: Kierling, 3. Juni 1924 684
Anhang 689
Anmerkungen 689
Bibliographie 731
Bildquellen 749
Personenregister 750
Verzeichnis der erwähnten Kafka-Texte 761
Danksagung 763
Vorwort
Franz Kafkas Wirklichkeit war ein weitläufiger Raum der Einbildungskraft. «Die ungeheuere Welt, die ich im Kopfe habe», notiert er im Juni 1913 in seinem Tagebuch (T II 179).[1] Während sich Kafkas äußeres Leben mit wenigen Ausnahmen in der überschaubaren Topographie Prags und der Provinzstädte Böhmens abspielt, bleibt die Erfahrung, die ihm das Reich des Imaginären vermittelt, unumschränkt und grenzenlos. Was sein literarisches Werk inspiriert, stammt nur in Bruchteilen aus den Zonen der externen Realität. Auf merkwürdige Weise scheint seine Welt der Phantasie von der wechselvollen Geschichte der Moderne unberührt. Die gravierenden Zäsuren, die Europa am Beginn des 20. Jahrhunderts bestimmen, spielen für Kafkas Leben scheinbar keine Rolle – weder seine Briefe noch die Tagebücher widmen ihnen größere Aufmerksamkeit. Die russische Revolution vom Winter 1905 taucht in der Erzählung Das Urteil auf, als sei sie ein gleichsam literarisches Ereignis. Die Balkankriege von 1912 und 1913 nimmt der Briefschreiber wie durch den Schleier des Tagtraums wahr (Br I 204). Die Mobilmachung vom August 1914 registriert der Tagebuchautor in einer lakonischen Beiläufigkeit, die befremdlich wirkt (T II 165). Dem Zusammenbruch der k.u.k.-Monarchie, der am 28. Oktober 1918 zur Geburt der tschechischen Republik führt, widmet er kaum ein Wort. Die Existenz des neuen Staates, als dessen Bürger er fortan lebt, ist ihm keinen näheren Kommentar wert; einzig über die bürokratischen Widerstände, denen sich der Reisende im Europa der Nachkriegszeit ausgesetzt sieht, klagt er gelegentlich. Als er 1923 nach Berlin zieht, beobachtet er die gesellschaftlichen Umbrüche des großen Inflationswinters wie ein Forscher, der den Gegenständen seiner wissenschaftlichen Neugier fernbleiben muß, um sie besser zu verstehen: «(…) und so weiß ich von der Welt viel weniger als in Prag.» (Br 468)
Als Visionär ohne Geschichte und Mystagogen ohne Realitätssinn haben die Nachgeborenen Kafka wahrgenommen. Das Porträt des einsamen Prager Asketen, der seine privaten Ängste und Obsessionen in traumhaft-phantastischen Texten verarbeitet, darf jedoch nicht davon ablenken, daß es auch noch eine andere Seite gibt. Sie zeigt dem Betrachter einen auf komplizierte Weise in die Epoche Verstrickten, der vor der gesellschaftlichen Wirklichkeit seiner Zeit die Augen nicht verschließt. Als Jurist in öffentlichen Diensten ist ihm die staatliche Bürokratie in Böhmen aus den Details eines grauen Büroalltags vertraut. Die Fabriken des Industriezeitalters, jene Schreckensorte im Inferno moderner Technik, hat er, anders als die meisten Schriftsteller des 20. Jahrhunderts, in seiner Rolle als Gutachter für den Unfallschutz bei Inspektionsbesuchen sehr genau kennengelernt. Seine privaten Reisen führen ihn durch die Länder Mitteleuropas, in die Schweiz, nach Frankreich und Oberitalien. Die großen europäischen Metropolen erkundet er mit der Neugier des Voyeurs, der vom nervösen Pulsschlag urbanen Lebens fasziniert ist. Sämtliche bedeutenden intellektuellen Strömungen der Zeit hat er aufmerksam registriert, ohne sich freilich von ihnen vereinnahmen zu lassen; Zionismus und Psychoanalyse, Anthroposophie und Naturheilkunde, Sozialismus und Anarchismus, Frauenbewegung und Pazifismus nimmt er als Epochenphänomene mit dem scharfen Blick des distanzierten Beobachters wahr. Sein Wissen verbirgt er dabei hinter der Maske des naiven Dilettanten, der die Souveränität bewundert, mit der die Akteure auf der Bühne des Geisteslebens ihre Rollen spielen.
Wer diese Selbstinszenierung als Tarnung durchschaut, erblickt einen sehr bewußt lebenden Zeitgenossen, dem seine kulturelle Umwelt niemals gleichgültig bleibt. Kafka hat seine besondere Identität als deutscher Jude in Prag, belehrt durch Theodor Herzls Zionismus und Martin Bubers Religionsphilosophie, mit wachsender Sensibilität reflektiert. Es ist das gesellschaftliche und kulturelle Milieu Böhmens im Zeitalter der jüdischen Assimilation, das seine Kindheit und Jugend am Ende des 19. Jahrhunderts bestimmt. Hier, vor dem Hintergrund einer verschatteten Überlieferung – der jüdischen Glaubenskultur – und auf dem Boden der technischen wie kulturellen Moderne, liegen die Voraussetzungen seiner ästhetischen Produktivität. Selbst wenn sein Werk die Spuren der Epoche stets nur indirekt verarbeitet, läßt es sich nicht lösen von deren politischen, sozialen und intellektuellen Signaturen. Auch der in seine Privatkonflikte eingesponnene Autor Kafka ist ein Künstler mit zeitgeschichtlich geprägter Identität, dessen literarische Arbeit unter den gesellschaftlichen Bedingungen eines katastrophenreichen Jahrhunderts steht.
Dieses Buch geht von der Beobachtung aus, daß Kafkas äußeres und inneres Leben zwar punktuell seine Texte inspiriert, umgekehrt aber auch die Literatur die Linien der Biographie festlegt. Kafka hat nicht selten in seinen poetischen Arbeiten Konstellationen der eigenen Vita vorweggenommen; man könnte, anders akzentuiert, auch sagen: er hat im Leben die Literatur nachgeahmt. Dieser Befund gilt etwa für das Verlobungsmotiv der Erzählung Das Urteil, das die Beziehung zu Felice Bauer antizipiert, aber ebenso für die tödliche Wunde des Jungen im Landarzt, die das Ausbrechen der Tuberkulose zu präludieren scheint. Es gehört zu den Grundmustern von Kafkas Leben, daß es sich im Geltungsbereich der Literatur abspielt und über ihn wesentlich definiert; das reflektieren zahlreiche Äußerungen in Tagebüchern und Briefen mit nicht ermüdender Intensität. Zentrale Aufgabe dieses Buchs ist es daher, die Prägungen zu beschreiben, die das Leben durch die imaginären Welten der Poesie und die Formen ihrer inneren Ordnung empfangen hat.[2] Erst die Einsicht in die literarische Konditionierung der Erfahrung erschließt das geheime – keineswegs mythische, vielmehr bewußt produzierte – Gesetz, das Kafkas Vita machtvoll regiert. In ihr existieren keine einfachen Lösungen, sondern nur Paradoxien und dialektische Verstrickungen, denen traditionelle Mythen wie das Bild vom asketischen, lebensängstlichen Schriftsteller so wenig gerecht werden wie ihre programmatischen Entzauberungen.
Man kann Kafka im Hinblick auf solche Paradoxien einen ‹ewigen Sohn› nennen, der seine Furcht vor dem Vater mit obsessiver Lust kultiviert, weil sie für ihn die Bedingung seiner Existenz bildet. Diese Konstellation bezeichnet ein Lebensprinzip, das Kafkas künstlerische Identität ebenso wie sein – von ihm selbst so empfundenes – Scheitern in der praktischen Wirklichkeit begründet. Kafka hat sich, obgleich er sich seines literarischen Rangs bewußt war, niemals aus der Rolle des Nachgeborenen befreit, der zögert, erwachsen zu werden. Seine Liebesgeschichten treiben in Katastrophen, da der Eintritt in die Rolle des Ehemanns oder Vaters seine Identität als Sohn zerstört hätte. Sie aber bildete die Voraussetzung für seine schriftstellerische Arbeit, die sich nach seiner Überzeugung nur in der unbedingten Einsamkeit vollziehen konnte. Nicht zuletzt wird in der Rolle des Sohnes die Logik seiner Texte deutlich, die endlose Reisen auf dem Meer der Bedeutungen unternehmen. Kafkas literarisches Werk ist einer Ästhetik des Zirkulären verpflichtet, in der sich die Ich-Konstruktion des ewigen Sohnes spiegelt: das ‹Zögern vor der Geburt›, wie er es genannt hat, das Verharren in Übergängen, Bruchstücken, Annäherungen. Der Sohn, der nicht erwachsen wird, reflektiert seine psychische Selbstorganisation in Texten, die so unabschließbar sind wie sein eigenes biographisches Projekt. Der Ich-Entwurf des ‹ewigen Sohnes› ist daher das Geheimnis der Künstlerpsychologie, die Kafkas Schreiben grundiert. Er führt, die Zufälle der äußeren Biographie wie Schwellen überschreitend, in jene Zone, die man die Dämonie des Lebens nennen mag: ins Arkanum der dunklen Verstrickungen, welche die dramatische Selbstinszenierung des Autors Kafka bestimmen.
Kafka ist kein Meteor, dessen Werk aus einem geschichtslosen Himmel über uns kam. Er steht vielmehr sehr bewußt in einem komplexen Überlieferungsgeschehen, das er freilich mit den Mitteln der Ironie, Travestie und Parodie, nicht selten gestützt durch die Denkmethode der negativen Dialektik, zu verfremden weiß. Die beiden Leitbegriffe, die dieses Überlieferungsgeschehen erschließen, lauten ‹Mythos› und ‹Moderne›. Mythos: das ist für Kafka wesentlich die Welt des Judentums, dessen religiöse Sagen, Geschichten und Handlungsanleitungen ursprünglich mündlich überliefert waren. Über das Gespräch gewinnt Kafka durch Bekannte und Freunde wie Hugo Bergmann, Max Brod, Felix Weltsch, Jizchak Löwy, Martin Buber und Jiři Langer Einblicke in die Erzählwelten der jüdischen Religion. Daß deren Muster die Texte des Landarzt-Bandes, den Proceß-Roman und das Spätwerk geprägt haben, läßt sich begründet nachweisen. Zugleich mischt sich in das Ensemble der legendenhaften Stoffe, die Kafka verarbeitet, die griechische Antike ein. Die Mythen des Kampfes, des Familienkonflikts und der Reise, die er aufgreift, stehen...
| Erscheint lt. Verlag | 26.1.2018 |
|---|---|
| Zusatzinfo | mit 43 Abbildungen |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Literatur ► Biografien / Erfahrungsberichte |
| Schlagworte | 20. Jahrhundert • Anthroposophie • Biografie • Biographie • Deutsche Literatur • Franz Kafka • Identität • Individualität • Interpretation • Jude • Judentum • jüdische Geistestradition • Kafka • Kino • Leben • Literatur • Moderne • Naturheilkunde • Österreich • Philosophie • Prag • Psychoanalyse • Rezeption • Schriftsteller • Theater • Weltliteratur • Werk • Zionismus |
| ISBN-10 | 3-406-68898-5 / 3406688985 |
| ISBN-13 | 978-3-406-68898-0 / 9783406688980 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 12,5 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: PDF (Portable Document Format)
Mit einem festen Seitenlayout eignet sich die PDF besonders für Fachbücher mit Spalten, Tabellen und Abbildungen. Eine PDF kann auf fast allen Geräten angezeigt werden, ist aber für kleine Displays (Smartphone, eReader) nur eingeschränkt geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür einen PDF-Viewer - z.B. den Adobe Reader oder Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür einen PDF-Viewer - z.B. die kostenlose Adobe Digital Editions-App.
Zusätzliches Feature: Online Lesen
Dieses eBook können Sie zusätzlich zum Download auch online im Webbrowser lesen.
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
Größe: 4,4 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Zusätzliches Feature: Online Lesen
Dieses eBook können Sie zusätzlich zum Download auch online im Webbrowser lesen.
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich