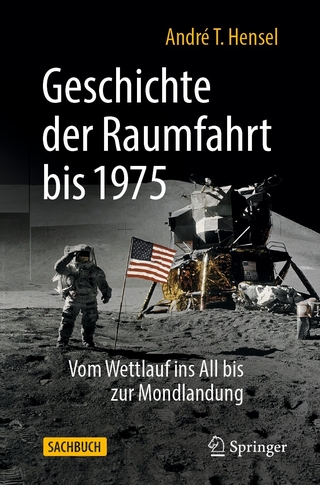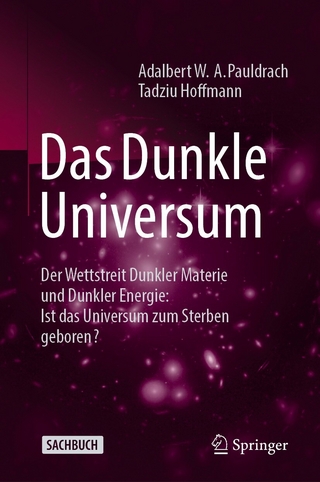Dunkle Materie (eBook)
128 Seiten
Verlag C.H.Beck
978-3-406-80291-1 (ISBN)
Sibylle Anderl ist Redakteurin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Sie hat in Astrophysik promoviert und am Institut de Planétologie et d'Astrophysique de Grenoble geforscht.
2. Was sich hinter der Dunklen Materie verbergen könnte
2.1 Astrophysikalische Ansätze: Suche nach Mikrolinsen
Astrophysiker sind es gewohnt, dass viele kosmische Phänomene schwer zu entdecken sind. Je mehr Bereiche des elektromagnetischen Spektrums sie zur Erkundung des Universums nutzen konnten, desto mehr Objekte und Prozesse ließen sich beobachten, die zuvor unsichtbar gewesen waren. Warum sollte es also nicht noch mehr im Kosmos geben, das sich den herkömmlichen astronomischen Methoden zwar direkt entzieht, ansonsten aber wenig rätselhaft ist? Vor diesem Hintergrund war es zunächst eine sinnvolle Annahme, dass die Dunkle Materie durch ganz normale astrophysikalische Phänomene zu erklären ist: Objekte wie massearme und daher leuchtschwache Sterne etwa, die sich unbemerkt im Halo der Galaxie befinden könnten, und dort zu der beobachteten Massendiskrepanz führen. Solche Objekte würde man sich als kompakte Materieklumpen vorstellen. Als Fachbezeichnung hat sich für sie der Term «MACHO» eingebürgert: MAssive Compact Halo Objects (massive kompakte Halo-Objekte).
Abbildung 7: Schematische Darstellung des Mikrolinseneffekts
Die Idee dazu, wie man solche MACHOs finden kann, formierte sich in den achtziger Jahren. Die Doktorandin Maria Petrou entwickelte während ihrer Doktorarbeit unter Anleitung von Donald Lynden-Bell in Cambridge die Überlegung, dass eine Variante des Gravitationslinseneffekts eine geeignete Suchmethode liefern könnte. Genau wie massereiche Galaxien als eine Art Linse wirken, indem ihr Gravitationsfeld gemäß Einsteins Relativitätstheorie das Licht von hinter ihnen liegenden Strahlungsquellen um sie herumführt, sollte das auch bei kleineren Objekten funktionieren. Allerdings würde es hier, anders als bei sehr massereichen Linsen, weder zu beobachtbaren Mehrfachbildern noch zu Einsteinringen kommen. Vielmehr würde eine zwischen dem Beobachter und der Hintergrundquelle, etwa einem Stern, hindurchlaufende «Mikrolinse» sich nur dadurch verraten, dass die Intensität der Quelle für einen kurzen Zeitraum verstärkt wird (siehe Abb. 7). Das liegt daran, dass sich der Raumwinkel, unter dem die Lichtquelle erscheint, durch die Lichtablenkung verändert, während der Strahlungsfluss der Quelle gleich bleibt. Dadurch, dass sich die relative Position von Beobachter, Linse und Hintergrundobjekt verschiebt, wird die Quelle daraufhin erst heller und wieder dunkler, und zwar in Form einer in der Zeit symmetrischen Kurve.
Natürlich gibt es auch Sterne, die aus anderen Gründen ihre Intensität mit der Zeit verändern. Allerdings gibt es eine Möglichkeit, diese intrinsische Variabilität eines Sterns von einem Mikrolinsenereignis zu unterscheiden, wie bereits Petrou feststellte: «Die Variabilität des Sterns wird sich von anderen Arten der Variabilität unterscheiden, denn es wird keine Veränderung seiner Farbe geben.» Mit anderen Worten: Der Mikrolinseneffekt beeinflusst alle vom Stern ausgesandten Wellenlängen auf dieselbe Weise, während natürliche Variabilität in verschiedenen Bereichen des Spektrums unterschiedlich ausfällt.
Wenn man konkret nach MACHOs im Halo unserer Milchstraße suchen wollte, könnte man nach entsprechenden Intensitätsveränderungen naher Sterne außerhalb unserer Galaxie Ausschau halten. Besonders geeignet wären als Hintergrundquellen die Sterne unserer nächsten Nachbargalaxie, der Großen Magellanschen Wolke. Dieser Satellit der Milchstraße ist von der Südhalbkugel als ausgedehnter Nebel am Nachthimmel sichtbar. Seine Entfernung liegt bei etwa 160.000 Lichtjahren – nah genug, um relativ problemlos einzelne Sterne auflösen zu können. Eine andere Möglichkeit ist die Beobachtung des Zentrums unserer Galaxie, da auch in dieser Richtung durch die galaktische Scheibe hindurch eine große Häufung von Sternen zu sehen ist und Linsenereignisse entsprechend wahrscheinlich sein sollten. Zudem bieten Beobachtungen in dieser Richtung auch eine Kontrolle an, ob die Methode überhaupt funktioniert: Durch Kenntnis der Verteilung der Sterne in der galaktischen Scheibe lässt sich die erwartete Anzahl von Ereignissen ausrechnen, bei denen ein Stern für einen anderen eine Linse darstellt – mit diesen Ereignissen ist mindestens zu rechnen, selbst wenn es keine MACHOs gibt.
Der Philosoph Ian Hacking hatte diesen Mikrolinseneffekt 1989 zum Anlass genommen, gegenüber der Astronomie insgesamt einen Vorbehalt zu formulieren, da er aus seiner Möglichkeit ableitete, man könne Intensitätsmessungen in der Astrophysik grundsätzlich nicht trauen. Sein Argument war etwa folgendes: Mikrolinsen lassen sich nicht direkt beobachten, sie können aber die Helligkeit oder Intensität beobachteter kosmischer Objekte verstärken. Auf der Intensitätsmessung kosmischer Objekte beruht ein großer Teil astrophysikalischer Theorie. Wenn man nicht weiß, ob eine Intensitätsmessung im speziellen Fall durch eine Mikrolinse gestört wurde, sind diese Messungen höchst unsicher und astrophysikalischen Modellen fehlt jede Zuverlässigkeit. Hacking hatte dabei allerdings außer Acht gelassen, dass nahe Mikrolinsen, wie oben beschrieben, nicht dauerhaft unseren Blick auf Hintergrundquellen stören, sondern eine zeitlich variable Verstärkung hervorrufen. Die zeitliche Variabilität ist also der Schlüssel, um die unsichtbaren Mikrolinsen zu entdecken.
Es ist ein betrübliches Detail, dass die Doktorandin Maria Petrou auf Anraten ihres Doktorvaters darauf verzichtete, ihre Überlegungen zu veröffentlichen, so dass der Ruhm für die Idee, den Mikrolinseneffekt für die Suche nach MACHOs zu nutzen, dem an der Universität Princeton arbeitenden polnischen Astronomen Bohdan Paczynski zufiel. Dieser hatte 1986 eine einfache und elegante Analyse des Mikrolinseneffekts veröffentlicht. Dass es prinzipiell funktionieren könnte, auf diese Weise nach kompakten dunklen Objekten im Halo der Milchstraße zu suchen, wurde daraufhin von den Astronomen allgemein akzeptiert. Die technische Umsetzung machte allerdings Probleme. Paczynski hatte ausgerechnet, dass man angesichts der geringen Wahrscheinlichkeit, dass sich eine Mikrolinse genau vor einem Stern der Magellanschen Wolke oder des Galaktischen Zentrums vorbeibewegt, ein Jahr lang einige Millionen Sterne pro Nacht beobachten müsste, um eine Reihe von Linsenereignissen erwarten zu können. Photographisch war das nicht zu machen. Das Projekt musste daher so lange warten, bis in den neunziger Jahren elektronische CCD-Arrays gebaut werden konnten. Selbst dann aber handelte es sich noch um eine ungeheure Herausforderung, ganz zu schweigen von der Bewältigung solch gigantischer Datenmengen.
Verschiedenen Gruppen gelang es, diese Hürden der Technologie- und Softwareentwicklung zu meistern. Paczynski selbst war angebunden an die polnische Gruppe OGLE (Optical Gravitational Lensing Experiment) um Andrzej Udalski, die im April 1992 mit Beobachtungen in Richtung des Galaktischen Zentrums begann. Dafür nutzte sie das 1 m-Swope-Teleskop am chilenischen Las-Campanas-Observatorium. Auch an der Universität Berkeley wurde ein großes CCD-Array entwickelt und am Great Melbourne Telescope im australischen Mount-Stromlo-Observatorium installiert. Mithilfe einer automatisierten Datenanalyse-Pipeline sollte dort in jeder Nacht das Licht von Sternen der Großen Magellanschen Wolke ausgewertet werden. Mitte 1992 begannen die Beobachtungen des «MACHO-Teams» von 1,8 Millionen Sternen. Parallel suchte seit 1990 auch eine französische Gruppe nach Mikrolinsen in Richtung der Großen Magellanschen Wolke, genannt «EROS» (Expérience de Recherche d’Objets Sombres). Sie nutzte zwei Teleskope: eines am chilenischen La-Silla-Observatorium der Europäischen Südsternwarte ESO, das andere am Observatoire de Haute-Provence. Auf diese Weise beobachteten die Franzosen drei Millionen Sterne.
1993 wurden die ersten Ergebnisse veröffentlicht: die der EROS- und MACHO-Gruppen in Nature, die der OGLE-Gruppe in der polnischen Fachzeitschrift Acta Astronomica. Das MACHO-Team hatte schon kurz nach Beginn der Beobachtungen das erste Mikrolinsenereignis aufgezeichnet. Der entsprechende Stern in der Großen Magellanschen Wolke war dabei siebenfach heller geworden. Die EROS-Gruppe hatte dagegen zwei potentielle Mikrolinsenereignisse beobachtet, eines im Dezember 1990, ein zweites im Februar 1992. OGLE vermeldete ein 1993 aufgezeichnetes Ereignis. Um aus diesen Beobachtungen weitergehende Schlüsse über die Verteilung dunkler kompakter Objekte im Milchstraßen-Halo zu ziehen, ...
| Erscheint lt. Verlag | 11.2.2023 |
|---|---|
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Kunst / Musik / Theater ► Malerei / Plastik |
| Naturwissenschaften ► Physik / Astronomie ► Astronomie / Astrophysik | |
| ISBN-10 | 3-406-80291-5 / 3406802915 |
| ISBN-13 | 978-3-406-80291-1 / 9783406802911 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 1,2 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich