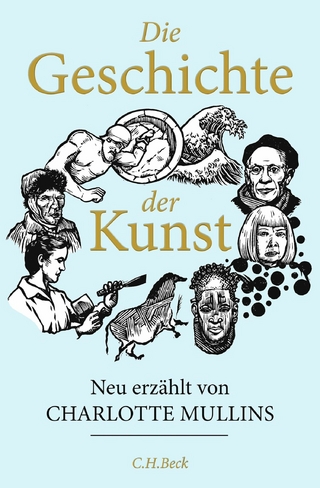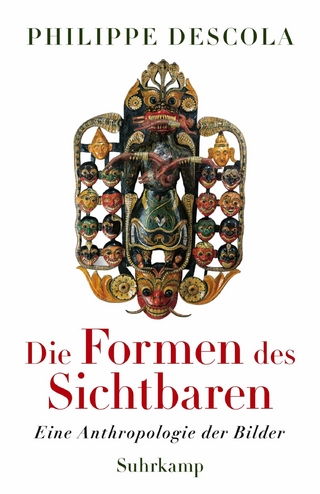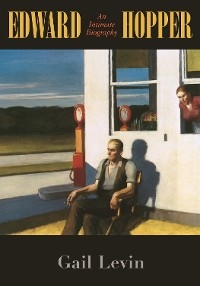Linke Heimatliebe (eBook)
148 Seiten
KVV Konkret (Verlag)
978-3-930786-89-3 (ISBN)
Besetztes Gebiet: die linke Heimat
Überall lese ich seit Monaten, man müsse die Heimat, um sie nicht den Rechten zu überlassen, von links besetzen. Meist ist schon den ersten Sätzen der Begründung abzulesen, was Besetzung meint. Wenn etwa die Friedrich-Ebert-Stiftung unter dem Titel »Linke Heimat« verlangt, den Rechten müsse »die Deutungshoheit abgerungen werden«, weil »blutleere Begriffe wie der Verfassungspatriotismus nicht in der Lage« seien, »die menschlichen Bedürfnisse nach Zugehörigkeit, Stolz, Selbstachtung, Ehre, Halt und Sicherheit zu befriedigen« und die »emotionale Bindung« zu schaffen, die »der Begriff Heimat« verspreche – ist schon fast alles beisammen, was das rechte Repertoire an Begriffen vorhält.
Wer eine einigermaßen moderne bürgerliche Demokratie »blutleer« nennt, knüpft direkt an den antidemokratischen Blut-und-Boden-Mythos völkischer Bewegungen an. Wer »Stolz« und »Ehre« zu »menschlichen Bedürfnissen«, also unhinterfragbaren anthropologischen Konstanten erklärt, schreibt seinen Text, ob er es nun bewusst tut oder nicht, von Kriegerdenkmälern und aus Landser-Romanen ab. Wie der Blogger Roberto J. De Lapuente, Autor für »Freitag« und »Neues Deutschland«, der »linkes Versagen« für die rechte »Deutungshoheit über das Heimatliche« verantwortlich macht: »Die haben den Begriff brachliegen lassen«, denn »der linke Geist war polyglott, kosmopolitisch und mondän« (ach, wär’s nur wahr!). »Das darf man sich im linken Lager nicht erlauben«, denn »die Heimat … ist eine menschliche Befindlichkeit, eine menschliche Bedingung, die sich auf das Raum-Zeit-Empfinden gründet«.
Etwas umsichtiger verfährt das »Historisch-kritische Wörterbuch des Marxismus« (aus dem Argument-Verlag). Es räumt ein, dass Luxemburg und Lenin auch bei genauester Lektüre kein heimatfreundlicher Halbsatz abzupressen ist und sich bei Marx nur Spott findet auf die »Verwandlung des Kommunismus in Liebesduselei«, der »die trauten Gefühle des Familienlebens, der Heimatlichkeit, des Volkstums nicht zerstören, sondern nur ›erfüllen‹« wolle. Etwas umsichtiger also, um dann doch mit der bekannten Pointe zu bedauern, »dass die Linke aufgehört hat, die Dialektik um Heimat auch nur zu denken … Der Heimatbegriff ist widersprüchlich wie die Verhältnisse selbst. Ob und wie Heimat als emanzipatorischer Begriff genutzt werden kann …, ist stets neu auszufechten.«
Erste Frage: Warum sollte man Begriffe, die zu den Rechten passen wie die Faust des Nazis aufs Auge des Kommunisten, nicht ihnen überlassen? Wie man Begriffe, die den Sozialdemokraten gehören, wie etwa »gerechter Lohn«, »antizyklische Wirtschaftspolitik« und »Sozialpartnerschaft«, den Sozialdemokraten überlässt. Dass sich hinter Begriffen entschlüsselbare Sehnsüchte verbergen, ist zwar nicht belanglos, denn es erklärt, warum sie unter kapitalistischen Verhältnissen ständig reproduzierbar sind, ist aber kein Grund, sie zu übernehmen, sondern einer, sie ihren Nutznießern um die Ohren zu hauen.
Nehmen wir den vergleichsweise harmlosen, durch Meinungsforschung und Einschaltquoten bewiesenen Neid der Deutschen auf Briten, Norweger, Schweden, Dänen, Belgier, Niederländer, Spanier, die noch ihre Königshäuser haben, mit Tradition und geregelter Erbfolge. Sie bieten allerlei Projektionsfläche für die unteren Klassen, deren Leben nicht viel Besseres zu bieten hat als Freude an Geburten und Hochzeiten anderer, Schadenfreude über deren Ehekrisen und Trauer über den Unfalltod einer Prinzessin. Da geht es gewiss um Emotionen (die von ganz vielen sogenannten Linken in jenen Ländern ernst interpretiert und genommen werden) – aber was hat unsereins damit zu schaffen? Was verdient es anderes als eine Kritik, die hier ein Mitfühlen als ähnliche Zumutung empfindet wie das Versprechen des Bundespräsidenten, einer für alle Staatsbürger zu sein und das Land nie zu spalten, sondern zu versöhnen.
Es ist eben so – ob ich das mit dem Attribut »leider« versehe oder nicht –, dass sich von Marx’ und Engels’ Befunden und hoffnungsvollen Prognosen jene als die unzutreffendste erwiesen hat, nach der der Kapitalismus die verklärenden Ideologien zum Verschwinden bringe. »Die Bourgeoisie«, schrieben sie, »hat alle feudalen, patriarchalischen, idyllischen Verhältnisse zerstört. Sie hat … kein anderes Band zwischen Mensch und Mensch übriggelassen als das nackte Interesse, als gefühllose ›bare Zahlung‹. Sie hat die heiligen Schauer der frommen Schwärmerei …, der spießbürgerlichen Wehmut in dem eiskalten Wasser egoistischer Berechnung ertränkt … Die Bourgeoisie hat dem Familienverhältnis seinen rührend-sentimentalen Schleier abgerissen und es auf sein reines Geldverhältnis zurückgeführt.« Dies alles hat die Bourgeoisie nicht getan, und auch das im Kommunistischen Manifest prognostizierte Verschwinden aller »religiösen und politischen Illusionen« ist ausgeblieben. Im Gegenteil: Kapitalismus produzierte neue heilige Schauer in größerer Zahl.
Dürfen wir neben der Heimat auch die »Volksgemeinschaft« nicht den Rechten überlassen? Die Frage klingt satirisch, aber wer weiß schon, welche Sau übermorgen durchs Dorf getrieben wird. Anknüpfungspunkte für einen solchen Irrsinn fänden sich jedenfalls in den Programmen und Proklamationen aller Parteien, die die »besten Jahre« der Weimarer Republik getragen haben, und eben nicht nur bei rechten Antidemokraten.
Die »Volksgemeinschaft«, das Ideal einer Gesellschaft ohne Klassenkampf, mit Sicherheit, Zusammenhalt und Geborgenheit, wurde – wie Michael Wildt in »Volksgemeinschaft als Selbstermächtigung« materialreich belegt – von den sogenannten Linksliberalen und dem katholischen Zentrum ebenso permanent im Munde geführt wie von dem Sozialdemokraten Friedrich Ebert, wenn er den »Geist von 1914«, die geschlossene Frontstellung gegen das bedrohliche Ausland, beschwört: »In diesem Kampfe unserer Selbstbehauptung … muss der Gedanke unserer festgefügten Volksgemeinschaft uns mehr und mehr in Fleisch und Blut übergehen.«
Das ist vielleicht nicht das Zitat, das sich für eine »linke« Besetzung des Begriffs Volksgemeinschaft am besten eignet, anders als ein Zitat aus dem SPD-Programm von 1922, bei dem es um Verstaatlichung und irgendwie schon gegen den noch unbekannten Neoliberalismus geht, denn es fordert: »Die Bodenschätze sowie die natürlichen Kraftquellen, die der Energieerzeugung dienen, sind der kapitalistischen Ausbeutung zu entziehen und in den Dienst der Volksgemeinschaft zu überführen.«
Was ich eben noch selbst als satirische Überspitzung gekennzeichnet habe, ist übrigens längst im »wissenschaftlichen Diskurs« angekommen. Steffen Bruendel, kein Linker zwar, aber ein astreiner Demokrat (und als Forschungsdirektor des Forschungszentrums für Historische Geisteswissenschaften der Goethe-Universität Frankfurt am Main alles andere als ein kleines Licht), wirft den Nationalsozialisten vor, sie hätten durch »inflationären Gebrauch den Begriff der Volksgemeinschaft … kontaminiert«. Wahr ist das Gegenteil: Weil das strukturell antidemokratische Ideal der Volksgemeinschaft so allgemein war, konnte die NSDAP so relativ leicht –und untermauert mit den bekannten Gemeinwohlformeln wie »Gemeinnutz geht vor Eigennutz« – politische Hoffnungen und Wünsche nach sozialer Inklusion und symbolischer Anerkennung der arbeitsamen Arier an sich binden, »Gefühle« nutzen und antisemitisch zuspitzen.
Die der Ebert-Regierung unterstehende »Zentrale für Heimatschutz« verkündete, die Abschaffung der Monarchie, die sie »Revolution« nannte, sei »der Anfang eines neuen Menschen. Sie ist der Anfang der Gemeinschaft des Volkes«. Dass diese Institution den »Heimatschutz« im Titel führte, verweist darauf, dass kaum etwas der Volksgemeinschaft so naheliegt wie die Heimat.
Die Annahme, der Begriff der Volksgemeinschaft sei in Deutschland ein »erledigter«, durch den Nationalsozialismus »für immer« diskreditierter, würde Land und Leute ganz zu Unrecht verharmlosen. 43 Prozent der Befragten (wenn man »voll und ganz« und »teils, teils« addiert) stimmen der Aussage zu: »Was Deutschland jetzt braucht, ist eine einzige starke Partei, die die Volksgemeinschaft insgesamt verkörpert« (Oliver Decker u.a.: »Flucht ins Autoritäre«).
Wir werden den volksgemeinschaftlichen Aspekten des linken Heimatbegriffs im Folgenden immer wieder begegnen. Wer Heimat sagt, affirmiert immer das Bestehende und macht Anleihen nicht unbedingt bei allen, aber bei den tragenden Säulen rechter Ideologie. So tat es die Linkspartei von Mecklenburg-Vorpommern im Wahlkampf mit dem Slogan: »Aus Liebe zu MV« auf jedem ihrer Plakate. Die irrsinnige Behauptung, man könne eine Gebietskörperschaft lieben, hatten sich alle Parteien zu eigen gemacht, besonders AfD und NPD, die das Copyright für die Parole beanspruchen. Ihre Besetzung durch die Linkspartei besagt zunächst einmal, dass in ihr kein Platz sei für Menschen, die Mecklenburg-Vorpommern nicht lieben, kein Platz für Nestbeschmutzer und Kritikaster also, und kein Platz für Menschen, die von irgendwo geflohen oder abgehauen sind, denn einem Syrer oder Ghanaer geht die Liebe zu Meckpomm nicht in gleicher Weise zu Herzen wie einem Eingeborenen.
(Der verlockenden Frage, ob man Vorpommern lieben kann, ohne Pommern zu lieben, gehe ich hier nicht weiter nach. Sie bedürfte wohl der Erörterung mit den zuständigen Vertriebenenverbänden.)
Die bewusste Pauschalität der »Liebe zu MV« schließt allereinfachste Reflexionen aus. Wie die, dass es meinetwegen ein paar naturschöne Ecken im Bundesland gibt und eben extrem hässliche: »So wahr es ist, dass ein jegliches in der Natur als...
| Erscheint lt. Verlag | 9.8.2019 |
|---|---|
| Reihe/Serie | Konkret Texte |
| Verlagsort | Hamburg |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Kunst / Musik / Theater ► Kunstgeschichte / Kunststile |
| Geisteswissenschaften ► Geschichte | |
| Schlagworte | Brauchtum • Dialektik • Heimat • Heimatbegriff • Heimatgefühl • Kritik • Linke • Nationalismus • Negation • Rechtsruck • Volksgemeinschaft |
| ISBN-10 | 3-930786-89-3 / 3930786893 |
| ISBN-13 | 978-3-930786-89-3 / 9783930786893 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 1,4 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich