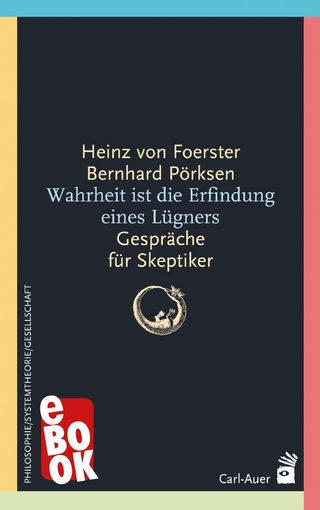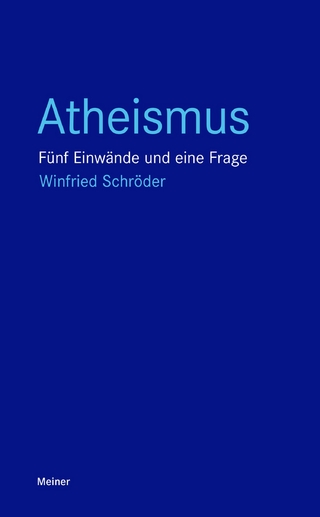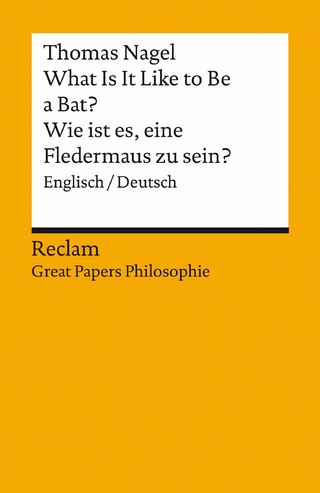Zurück zum Fortschritt (eBook)
188 Seiten
Felix Meiner Verlag
978-3-7873-4456-7 (ISBN)
Heiner Hastedt ist Inhaber des Lehrstuhls für Praktische Philosophie an der Universität Rostock. Zwischen 1998 und 2002 wirkte er als Prorektor für Struktur und Entwicklungsplanung (1998-2000) sowie für Internationales und Öffentlichkeitsarbeit (2000-2002). Zuletzt gab er bei Meiner heraus: »Macht und Reflexion« (Deutsches Jahrbuch Philosophie Band 6)
Heiner Hastedt ist Inhaber des Lehrstuhls für Praktische Philosophie an der Universität Rostock. Zwischen 1998 und 2002 wirkte er als Prorektor für Struktur und Entwicklungsplanung (1998–2000) sowie für Internationales und Öffentlichkeitsarbeit (2000–2002). Bei Meiner erschien zuletzt: »Macht der Korruption. Eine philosophische Spurensuche« (2020); »Macht und Reflexion« (Deutsches Jahrbuch Philosophie Band 6; 2016).
1
GEWALT, MACHT, DEUTUNGSMACHT
Eine Welt ohne oder zumindest mit weniger Gewalt stellt für die meisten heute Lebenden eine bessere Welt dar und manifestiert – so der später noch zu thematisierende Steven Pinker – einen Fortschritt in der Geschichte der Menschheit, in der Gewalt eine geradezu zentrale Rolle spielt. Ob auch eine Welt mit weniger Macht und Deutungsmacht eine bessere wäre, lässt sich im Gegensatz zur Gewalt bestreiten. Schon an diesem Punkt kündigt sich eine untersuchungsbedürftige Differenz zwischen einerseits Gewalt sowie andererseits Macht und Deutungsmacht an. Im Zentrum der Bedeutung von Gewalt steht die körperliche Brutalität als physischer Zwang von Menschen gegenüber Menschen, die zu mehr oder weniger schweren Verletzungen bis hin zum Tod führt oder führen kann. In Annäherung an die Gegenwart wird zunehmend psychischer Zwang, der über eine äußerlich bleibende Form der Manipulation hinausgeht, in die Gewaltdefinition einbezogen, insbesondere wenn Zwang angedroht wird und auf eine grausame Demütigung zielt.9 Gewalt als eng gefasster Begriff lässt sich mit Judith Shklar durch Grausamkeit charakterisieren und so von der Macht abgrenzen: Da Gewalt normativ nur im Ausnahmefall zum Beispiel der Notwehr rechtfertigungsfähig ist, geht mit der Einstufung als Gewalt im Normalfall aufgrund der den Begriff bestimmenden Grausamkeit eine Ablehnung einher. Nach diesen Umschreibungen sind kriminelle Aktionen unter Nutzung oder Androhung von Waffen ebenso wie körperliche Züchtigung und sexualisierte Nötigungen eindeutige Formen von Gewalt. Mobbing in Arbeitsverhältnissen oder im Internet sowie Stalking gehören wegen ihres psychischen Nötigungscharakters ebenfalls ins Spektrum der Gewalt. Unübersichtlicher ist in der Bewertung das Konzept der strukturellen Gewalt, wie es von Johan Galtung entwickelt worden ist. Neben Aspekten, die auf die vielfältige Gewalt von Verhältnissen unabhängig von Gewalt zwischen Personen aufmerksam machen, gibt es die problematische Tendenz, jede Beschwernis mit dem Ausdruck »Gewalt« zu belegen: Freiheitsberaubung ist eine Form der Gewalt, die dann als strukturelle angesehen werden kann, wenn beispielsweise ganze Teile einer Bevölkerung in einem eng gefassten Territorium eingesperrt werden. Eine solche strukturelle Gewalt kann so konzipiert sein, dass die unmittelbare Gewaltanwendung durch Personen die Ausnahme bleibt. Wenn in der »Corona«-Pandemie das verpflichtende Tragen von Masken als Freiheitseinschränkung und damit strukturelle Gewalt verstanden wird, dann scheint allerdings jedes Maß verlorenzugehen und der Gewaltbegriff überdehnt zu werden. Strukturelle Gewalt sehe ich als ein graduelles Konzept an, das auf der einen Seite zu Recht genutzt wird, auf der anderen Seite jedoch ohne Trennschärfe in kontroversen Debatten zur Diffamierung anderer Sichtweisen dient. Lebensbedrohlicher Hunger, der in vielen Ländern, insbesondere bei der von Paul Collier sogenannten »untersten Milliarde«, an der Tagesordnung ist, gehört eindeutig in das Themenfeld der strukturellen Gewalt. Aus der berechtigten Sicht der Betroffenen ist ein solches Hungern ein klarer Fall von Gewalt, aber es wäre inkonsistent, einerseits aus dieser Perspektive das Strukturelle zu betonen und andererseits strukturvergessen ganz auf Personen fixiert Täter benennen zu wollen. Personale Gewalt erfordert die Überführung einzelner Täter; strukturelle Gewalt verlangt nach überpersonalen Auswegen. Insgesamt hat das Konzept der strukturellen Gewalt seine wichtige Bedeutung in der Kritik von Verhältnissen, aber Verantwortliche für diese Form der Gewalt lassen sich weniger einfach finden als im personalen Fall. In der Summe ist Gewalt in seiner definierenden Bezugnahme auf Grausamkeit normativ zu vermeiden; dies trifft auf öffentliche Gewalt ebenso zu wie auf Gewalt im Privaten.
Im Alltag wird Macht oft mit Gewalt (oder auch mit Zwang und Herrschaft als hier nicht eigens diskutierten Begriffen) assoziiert und nicht selten wird dann – so in einer Einführung zu Theorien der Macht – »Gewalt als eine Steigerungsform der Macht« gesehen. Ziel muss bei einem solchen Machtbegriff eine Welt ohne Macht sein. Die Bewertung von Macht ist allerdings in der Philosophie im Vergleich zur fast immer als negativ einzuschätzenden Gewalt deutlich ambivalenter: Vom »Lob der Macht« bis zur »Kritik der Macht« lässt sich eine vermutlich noch zu vergrößernde Spannweite der Bewertung finden.10 Eine Kritik der Macht legt eine Welt ohne Macht nahe und wird von Urteilen wie dem von Lord Acton inspiriert: »Macht korrumpiert, absolute Macht korrumpiert absolut.« Demgegenüber betont Rainer Hank in seinem »Lob der Macht« das dauerhaft überwiegend Segensreiche der Macht und strebt keine »Utopie der Machtlosigkeit« an. Die Brücke zwischen beiden Ansichten könnte die Unterscheidung bilden, dass manche Formen der Macht erwünscht und andere unerwünscht sind. Doch was bedeutet das für die Definition der Macht? Zur ersten Annäherung schlage ich folgende Umschreibung vor: Macht bezeichnet die Fähigkeiten von Menschen und von sozialen Verbänden, auf andere Menschen und Verbände mit Erfolg einzuwirken. Das Einwirkungsverhältnis ist aber nicht im Sinne der Gewalt als direktem Zwang oder auch nur im Sinne eines zwingenden Kausalverhältnisses zu verstehen, sondern die Macht erhöht lediglich die Wahrscheinlichkeit, dass ihrem Einfluss gefolgt wird. Macht als Einfluss verstanden ist nicht grundsätzlich unvereinbar mit Handlungsfreiheit, zumal wenn sie in der Tradition der Aufklärung mit Hank als den Horizont öffnende Ermöglichung verstanden wird: »Macht ist nicht schlimm, solange sie bestreitbar ist, ökonomisch gesprochen: solange der Markt der Macht offen ist.« Beispiele für legitime Macht sind verfassungsgemäß zustande gekommene Parlamentsentscheidungen, die Anspruch auf eine Durchsetzung haben. Interessant ist die Frage nach der Macht des Geldes; denn offensichtlich erhöhen sich durch Geld und vor allem durch viel Geld die Chancen auf die Durchsetzung eigener Ziele. Wenn andere von solchen Zielen negativ betroffen sind, stellen sich Herausforderungen, ob hiergegen im »Wettbewerb als Entmachtungsverfahren« erfolgreiche Gegenmächte mobilisierbar sind. In vielen Fällen ist Macht nicht das Problem, sondern die mit Macht verbundenen »Missetaten« und vor allen die »Monopolisierung der Macht«.11 Die prinzipielle Bestreitbarkeit der Macht und die Chance auf ihre Entmachtung ist für die Legitimität der Macht zentral. Die wohl gegenwärtig am häufigsten zitierte Umschreibung von Macht, deren Vermeidung keineswegs wünschenswert ist, stammt von Max Weber. In einer kurzen Passage in »Wirtschaft und Gesellschaft« charakterisiert er Macht als Durchsetzungschance: »Macht bedeutet jede Chance, innerhalb einer sozialen Beziehung den eigenen Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen, gleichviel worauf diese Chance beruht.« Als Elemente von Webers Umschreibung lassen sich unterscheiden: das Chancenhafte der Macht, die keineswegs auf gewisse Realisierung setzen kann, das Widerstreben, das immer auch mit Gegenmacht rechnet, und vor allem die Konzentrierung von Macht zunächst auf eine Beziehung zwischen Personen.
Deutungsmacht ist unter der Überschrift der Macht aufgrund seines herausgestellten Deutungsanteils gesondert thematisierbar: Der Interpretations- und Kommunikationsanteil, der verbal oder nicht verbal zum Ausdruck kommt, greift im Fall der Deutungsmacht in das Einflussverhältnis ein. Daraus ergeben sich unterschiedliche Formen der Deutungsmacht, auf die später noch differenziert eingegangen wird. Generell ist Deutungsmacht als soft power filigran und entfernt sich so nicht nur von der Gewalt, sondern auch von plumperen Formen der Macht. Hinter der mächtigen Parlamentsentscheidung und dem Wirken des Papstes als Teil einer Institution stehen Legitimitätsauffassungen, die sie deutend tragen; für die Macht des Geldes gibt es viele ökonomische Theorien, die ihre freie Entfaltung im Kapitalismus rechtfertigen oder umgekehrt mehr oder weniger grundsätzlich kritisieren. Hinsichtlich des Verhältnisses von Macht und Deutungsmacht muss mit mindestens drei Lesarten gerechnet werden, die jeweils gute Argumente auf ihrer Seite haben: Nach der einen hat Deutungsmacht immer einen integralen Anteil an jeder Form der Macht, so dass Macht immer Deutungsmacht enthält. Nach der zweiten Lesart ist Deutungsmacht eine Unterklasse der Macht, die sich von anderen Machtformen und von Gewalt unterscheidet. In einer dritten Lesart wird davon ausgegangen, dass beide Lesarten richtig sein können, wenn in manchen Kulturen und zu manchen Zeiten jede Erscheinung der Macht mit Deutungen verbunden, aber nicht immer und überall Deutungsmacht an Macht beteiligt ist. Die Abgrenzung von Macht und Deutungsmacht gelingt zwar rein äußerlich schon über das begriffliche Hinzukommen der Deutung, aber die Abgrenzbarkeit in der Wirklichkeit erfordert eine...
| Erscheint lt. Verlag | 27.9.2023 |
|---|---|
| Reihe/Serie | Blaue Reihe |
| Verlagsort | Hamburg |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Geisteswissenschaften ► Philosophie ► Philosophie der Neuzeit |
| Schlagworte | Politische Philosophie • Sozialphilosophie • Theorie der Macht • Wahrheitstheorie |
| ISBN-10 | 3-7873-4456-X / 378734456X |
| ISBN-13 | 978-3-7873-4456-7 / 9783787344567 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 415 KB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich