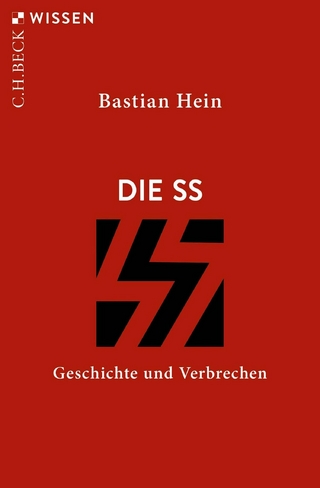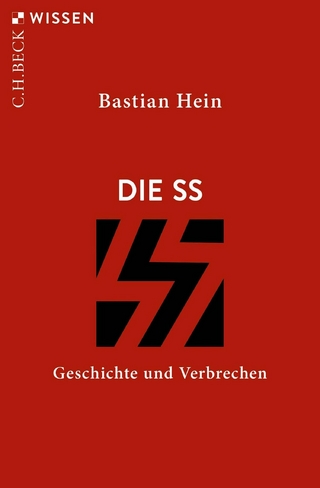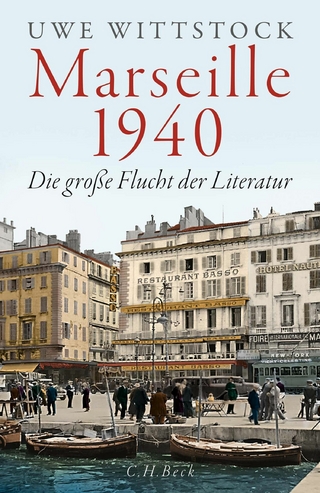Wie schreibt man Internationale Geschichte? (eBook)
371 Seiten
Campus Verlag
978-3-593-45210-4 (ISBN)
Arvid Schors, Dr. phil., ist Akademischer Rat auf Zeit am Lehrstuhl für Internationale Geschichte und historische Friedens- und Konfliktforschung an der Universität zu Köln. Fabian Klose ist Professor für Internationale Geschichte und historische Friedens- und Konfliktforschung an der Universität zu Köln.
Arvid Schors, Dr. phil., ist Akademischer Rat auf Zeit am Lehrstuhl für Internationale Geschichte und historische Friedens- und Konfliktforschung an der Universität zu Köln. Fabian Klose ist Professor für Internationale Geschichte und historische Friedens- und Konfliktforschung an der Universität zu Köln.
Pelzrobben in Paris. Ressourcenkonflikte, Umweltwissen und die Bering Sea Arbitration 1893
Robert Kindler
Wo, von wem und auf welche Weise durften Pelzrobben der Art callorhinus ursinus getötet werden? Ein Vierteljahrhundert benötigten die Diplomaten Großbritanniens, Japans, Kanadas, der Vereinigten Staaten und Russlands, um eine Antwort auf diese so einfach scheinende und doch so komplexe Frage zu finden. Sie belastete das Verhältnis der beteiligten Staaten in erheblichem Maße, brachte die nordpazifischen Pelzrobbenpopulationen an den Rand der Ausrottung und verschaffte dem »Nördlichen Seebären« (so die deutsche Bezeichnung) zweifelhaften Ruhm: Er sei, so vermutete ein Autor, »wohl das Tier, über dessen Lebensverhältnisse von Staatswegen am meisten geschrieben worden ist«,58 und galt zeitweilig als »the most controversial animal in the history of modern diplomacy«.59
Robben wurden zum Gegenstand internationaler Konflikte, weil ihre Felle im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts zu den wertvollsten und begehrtesten Waren auf dem Rauchwarenmarkt gehörten. Mäntel und Kopfbedeckungen aus sealskin standen in den Metropolen des globalen Nordens als Statussymbole und modische Luxusobjekte hoch im Kurs.60 Die Preise für die Felle stiegen unaufhörlich, und in den 1880er Jahren drängten immer mehr Konkurrenten in das lukrative Geschäft, das zuvor von einem US-amerikanischen Unternehmen monopolisiert worden war. Im Unterschied zur bis dahin üblichen Praxis jagten diese sogenannten sealers die Robben auf hoher See – und gerieten in Konflikt mit den US-Behörden. Weil viele der pelagischen Robbenfänger aus Kanada stammten, kam es binnen kürzester Zeit zu diplomatischen Auseinandersetzungen zwischen den USA und Großbritannien um die Fangrechte. Denn nun standen nicht nur wirtschaftliche Interessen auf dem Spiel, sondern es ging um ganz grundsätzliche Probleme des staatlichen Zugriffs auf maritime Räume und Ressourcen. Verlauf und Ausgang des nordpazifischen Robbenstreits nahmen daher viele jener Konfliktkonstellationen vorweg, die die internationale Politik auch im 20. Jahrhundert immer wieder beschäftigen sollten.61
Mit Ressourcenkonflikten und diplomatischen Aushandlungsprozessen geht es hier um zwei der »klassischen« Problemfelder der Internationalen Geschichte.62 Doch stehen dabei weniger die Resultate des Konflikts um die Robben im Vordergrund als vielmehr der Zusammenhang von umstrittenem Expertenwissen und der Instrumentalisierung dieses Wissens. Denn: Der Streit um die Robben selbst schuf die Voraussetzungen zu seiner Lösung. Weil die Kontrolle über diese Tiere höchst kontrovers diskutiert wurde, gehörten sie um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert auch zu den am besten erforschten Meeressäugern überhaupt. Das außerordentliche wissenschaftliche (und öffentliche) Interesse an den fur seals hing unmittelbar mit den internationalen Aushandlungsprozessen über ihr Schicksal zusammen. Belastbare Entscheidungen ließen sich ohne genaue Kenntnisse biologischer und ökologischer Zusammenhänge kaum treffen. Ein derartiges Wissen stand den Diplomaten keineswegs von Anfang an zur Verfügung, vielmehr entstand es vielfach erst im Kontext der Auseinandersetzungen selbst. »Robbendiplomatie» und »Robbenwissen« bedingten einander also.
Es waren unterschiedliche Wissensbestände, mit denen Diplomaten und Juristen operierten:63 Neben dezidiert naturwissenschaftlicher Expertise spielten auch Beobachtungen und Erfahrungswissen von Beamten, Robbenjägern und insbesondere von Angehörigen indigener Bevölkerungsgruppen eine zentrale Rolle. Hinzu kamen moralisch aufgeladene Argumente, die einerseits die menschliche Verantwortung gegenüber bedrohten Spezies betonten und andererseits »grausame« Tötungsmethoden kritisierten.64 Diese mitunter widersprüchlichen Diskurse wurden Teil und Gegenstand wechselseitiger Vorhaltungen und gemeinsamer Verhandlungen. Interpretation und Instrumentalisierung konfligierender Wissensinhalte blieben dabei ebenso umstritten wie die Frage, welche Relevanz unterschiedlichen Formen des Wissens beigemessen werden sollte.
Die Geschichte des Kampfes um die Robben und seiner Beilegung ist vielfach beschrieben worden.65 Die meisten Untersuchungen interessierten sich vor allem für den – letztlich erfolgreichen – Ausgang der jahrzehntelangen diplomatischen Debatten und sahen darin frühe Manifestationen einer conservation diplomacy. Sie präsentierten eine gleichsam teleologische Erzählung, die auf die Rettung der Tiere mit den Mitteln der Diplomatie zusteuerte. Als Höhe- und Endpunkt gilt solchen Studien die 1911 in Washington zwischen den USA, Großbritannien, Japan und Russland ausgehandelte North Pacific Fur Seal Convention, die den Fortbestand der nordpazifischen Pelzrobbenpopulation dauerhaft sicherte.66 Dieses Abkommen gilt bis heute als ein zentraler Meilenstein zur Etablierung internationaler Artenschutzabkommen. Schließlich gelang es hier, Artenschutz und ökonomische Interessen der beteiligten Akteure zu vereinen. Auch deshalb ging seine Bedeutung weit über den eigentlichen Gegenstand hinaus.67
Angesichts der historiographischen Konzentration auf diesen unbestreitbaren Erfolg multilateraler Kooperation traten andere Schlüsselmomente der Robbendiplomatie in den Hintergrund. Dies galt besonders für die Bering Sea Arbitration von 1893, ein internationales Schiedsgerichtsverfahren, in dem die USA und Großbritannien ihren Konflikt beizulegen suchten.68 Die öffentlich geführten Verhandlungen fanden in Paris statt, und sie waren weit mehr als lediglich eine Etappe auf dem Weg zur schlussendlichen Lösung des fur seal-Problems: Hier gelang es erstmals, auf internationaler Ebene einen – wenngleich vielfach kritisierten – Ausgleich zwischen ökonomischen Interessen und ökologischen Notwendigkeiten zu finden. Vor allem aber wurde das Tribunal zu einem Forum, auf dem permanent über die Signifikanz unterschiedlicher Formen von »Umweltwissen«69 gestritten wurde. Damit trug das Verfahren entscheidend dazu bei, die Art und Weise zu verändern, wie Ressourcenkonflikte auf zwischenstaatlicher Ebene verhandelt wurden.70 Nun spielten nicht mehr allein völkerrechtliche Argumente eine Rolle, sondern auch Fragen wie die Endlichkeit natürlicher Ressourcen oder die moralische Verantwortung für Flora und Fauna wurden in Paris ausführlich thematisiert. Vor allem aber ging es um das Leben und Töten der Robben selbst. Damit bietet die umfangreiche Quellenüberlieferung der Bering Sea Arbitration Einblicke in das zeitgenössische Umweltwissen des ausgehenden 19. Jahrhunderts und seine unterschiedlichen Repräsentationen.
Die Geschichte des Pariser Tribunals lässt sich also – so wie die Geschichte der Diplomatie insgesamt – als Geschichte des Wissens und des Kampfes um Deutungshoheit begreifen.71 Schließlich besteht die Kunst der Diplomatinnen stets darin, komplexe Sachverhalte zu durchdringen und interessengeleitet zu verhandeln. Dabei sind sie mit konkurrierenden Epistemologien konfrontiert und müssen mit scheinbar inkompatiblen kulturellen Codes oder Wissensordnungen umgehen.72 Zudem sind Diplomaten permanent mit dem Problem der »Funktionalisierung« und Instrumentalisierung von Wissen konfrontiert, was auch Praktiken der Verschleierung und des gezielt eingesetzten »Nichtwissens« beinhalten kann.73
Diplomatische Prozesse und internationale Konferenzen waren – vor allem seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts – zentral für die globale Etablierung und Zirkulation spezifischer Ordnungen und Hierarchien des Wissens. Diplomaten interagierten dabei mit Wissenschaftlerinnen und (vermeintlichen) Experten, aber auch mit anderen Akteuren wie Schriftstellern oder Aktivistinnen. Auf diese Weise instrumentalisierten sie Wissen für ihre Zwecke und trugen dazu bei, es zu tradieren und zu normieren.74 Damit aber veränderte sich auch die Diplomatie selbst: Zwar blieb sie um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert den Werten und Traditionen des zu Ende gehenden Jahrhunderts verhaftet,75 erschloss...
| Erscheint lt. Verlag | 17.5.2023 |
|---|---|
| Co-Autor | Nils Bennemann, Sarah Ehlers, Julia Eichenberg, Elisabeth Gallas, Petra Goedde, Silke Hackenesch, Madeleine Herren-Oesch, Anna Karla, Robert Kindler, Fabian Klose, Sarah Panter, Friedemann Pestel, Arvid Schors, Katharina Stornig, Sebastian Teupe |
| Verlagsort | Frankfurt am Main |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Geschichte ► Allgemeine Geschichte ► 1918 bis 1945 |
| Schlagworte | 19. Jahrhundert • 20. Jahrhundert • 21. Jahrhundert • Diplomatie • Diplomatiegeschichte • Familie • Geschichtswissenschaft • Geschlechtergeschichte • Globalgeschichte • Internationale Beziehungen • Internationale Geschichte • Kultur • Netzwerke • Politikgeschichte • Rechtsgeschichte • Transnationale Geschichte • transnationale Netzwerke • Transregionale Geschichte • Wirtschaftsgeschichte • Wissen • Wissensgeschichte |
| ISBN-10 | 3-593-45210-3 / 3593452103 |
| ISBN-13 | 978-3-593-45210-4 / 9783593452104 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 6,7 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich